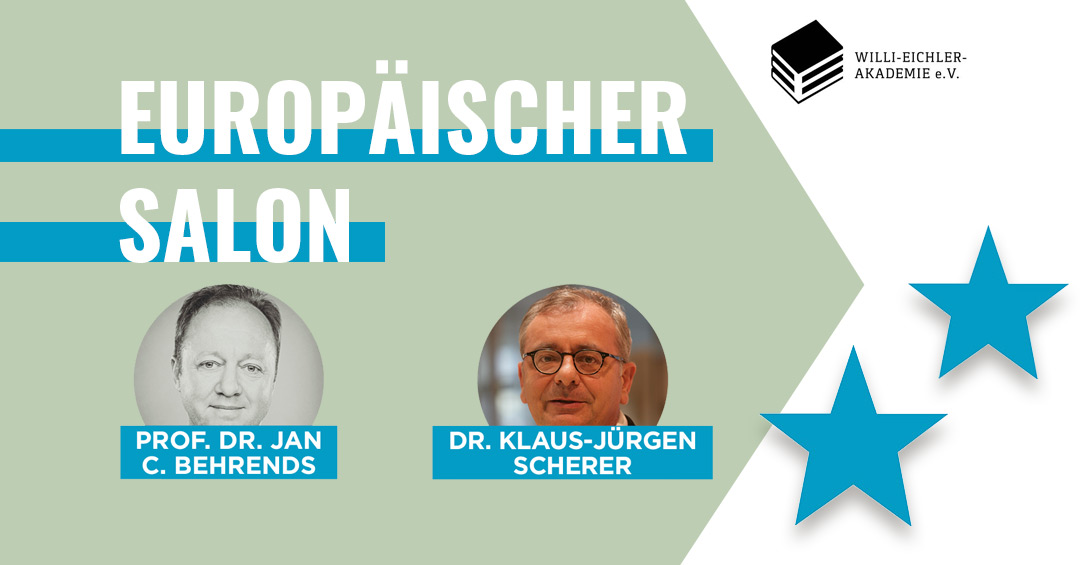Europäischer Salon
27. September 2022
Veranstaltungsort: buchhandlung + antiquariat, Stresemannstraße 28, 10963 Berlin
Am 27. September 2022 fand unser „Europäischer Salon“ in der vorwärts: Buchhandlung in Berlin mit dem Historiker Prof. Dr. Jan C. Behrends, Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, im Rahmen unseres Projektes „Transformation der Erinnerung – Transformation der Aufarbeitung“ unter der Moderation von Klaus-Jürgen Scherer statt.
Wir wollten der Frage nachgehen, wohin Osteuropa über dreißig Jahre nach dem Mauerfall und angesichts des Ukrainekrieges heute steuert.
Mit den Revolutionen des Jahres 1989 setzten sich in den ost- und mitteleuropäischen Ländern Freiheit und die demokratische Lebensweise durch. Im Herbst 89 herrschte Euphorie, viele Jahre noch Optimismus. Doch es mussten auch die Mühen der Ebene durchschritten werden, die von breiter Verarmung und hartem Strukturwandel gekennzeichnet waren, im Osten Europa auch von Manchesterkapitalismus und in Jugoslawien von Krieg. Eine Nostalgie für die sozialistische Epoche war bald weit verbreitet.
Es etablierte sich eine neue Friedensordnung, bei der alle Rückschläge und Gewalteskalationen für die Bewohner West- und Zentraleuropas als regionale, lokale Probleme erschienen. Sowohl die Despotie als auch der Krieg schien irgendwie „weit weg“, Ordnungen von Recht und Freiheit wirkten bis in den postsowjetischen Orbit hinein gesichert. Aber haben wir Russland und seine Nachbarn wirklich genau beobachtet? Schien uns die Friedensordnung zu sehr gesichert, so dass wir sie verspielt haben? Waren wir „im Westen“ einfach auch zu ignorant und haben gar nicht mehr richtig hingesehen, uns nicht mehr interessiert?
Die Zeitenwende durch den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist das Ende einer Welt, in der wir friedlich lebten. Wir wissen nicht, was aus diesem historischen Einschnitt folgen wird, die Ängste und Ungewissheiten sind groß. In jedem Fall aber ist das Resultat eine tiefe Erschütterung und Infragestellung von vertrauten Gewissheiten, die so selbstverständlich waren.
Was ist von den Demokratiebewegungen der Epochenwende im Ostblock 30 Jahre später geblieben? Was ist aus den damaligen Hoffnungen und Visionen geworden? Wie viel ist von dieser erkämpften Freiheit in vielen osteuropäischen Staaten übrig? Wo wird auch heute noch für diese Freiheit gekämpft? Wo sind heute neue Demokratiebewegungen sichtbar und können Europa befruchten?Wenn wir den Blick auf die historischen Situationen richten und konkret die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Folgewirkungen in den Fokus nehmen, uns mit den Folgen der Spaltung auseinandersetzen, den Erschütterungen, Revolutionen und Veränderungen der letzten 30 Jahre nachspüren, dem Krieg in der Ukraine, wo stehen wir heute?
„Mit Professor Behrends haben wir einen der führenden Experten im Grunde der Zeitgeschichte Osteuropas als Gesprächspartner gewonnen. Seit März hat er eine besondere Professur an der Europa Universität. In seiner dortigen Antrittsvorlesung hat er vom Ende der postsowjetischen Epoche oder die Bedeutung der 90er Jahre für das 21. Jahrhundert gesprochen und diesen Bogen wollen wir auch ziehen“, so Klaus-Jürgen Scherer. „Also es soll um die osteuropäischen Staaten gehen und um den Bogen hin zum Ukraine Krieg. Die Frage, wohin steuert Osteuropa? Auch nach den Wahlen in Schweden und Italien stellt sich die Frage, wohin steuert überhaupt ganz Europa, nicht nur Osteuropa?“
„Für mich selbst als Wissenschaftler ist am 24. Februar tatsächlich auch eine Epoche zu Ende gegangen. Aber es war auch ein privater Einschnitt für mich, sozusagen als jemand, der 30 Jahre sich mit Osteuropa beschäftigt hat, dieser Kriegsbeginn“, so Jan C. Behrends.„Das sind Situationen, auf die ich auch nicht vorbereitet war und von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich das sozusagen in meinem Forscher- und Wissenschaftlerleben noch mal so erleben muss“, sagt Behrends. „Und auch dieses Sommersemester an der Viadrina, Sie erwähnten es ja schon, dass ich da jetzt unterrichte seit einiger Zeit, war natürlich sehr dramatisch, weil jedes Mal, wenn man da ankam, auf dem Bahnhof in Frankfurt/Oder, dann waren entweder 2500 Leute aus Charkiw oder Odessa oder irgendeiner anderen ukrainischen Stadt da in der Bahnhofshalle und haben in Deutschland Zuflucht gesucht. Da waren die Helfer teilweise meine Studenten, die da Erste Hilfe, geleistet haben. Das sind schon außerordentliche Szenen gewesen, die ich in meinem Leben auch nicht wieder vergessen werde, was ich da erlebt habe. Ich war jetzt noch nicht wieder in der Ukraine, aber wir hatten auch genug hier zu tun. Es hat dann wirklich sich das Private sozusagen mit dem Wissenschaftlichen und dem Politischen verbunden.“„Aber was bedeutet das alles politisch und historisch für uns? Ich glaube, dass es sozusagen an der Zeit ist, einerseits zu sagen und das habe ich in besagter Antrittsvorlesung versucht ein bisschen auszuführen, und da können wir gerne auch heute drüber sprechen, dass diese postsowjetische Epoche eigentlich jetzt zu Ende ist und dass man noch nicht genau weiß, was jetzt danach kommt, welchen Namen man dieser neuen Epoche geben soll.“Behrends glaubt, dass sich „diese ganze postsowjetische Zustand sich mit dem Krieg mit einem Knall verabschiedet hat. Wir sind jetzt in einer anderen Welt, von der wir noch nicht genau wissen, wie der Krieg ausgeht, welche Resultate das haben wird. Aber es ist sicherlich nicht mehr die Welt, die 1989/91 gegründet wurde und die über drei Jahrzehnte doch eine Transformation, die wir heute nacherzählen können, gesehen hat. Ja, die Geschichten, die wir über Osteuropa erzählen können für die Zeit nach 1989/91, die sind natürlich von der Perspektive abhängig und da muss man sich, glaube ich, konstatieren, dass die deutsche Öffentlichkeit aus einer sehr deutschen Perspektive darauf geschaut hat. Unser Ziel als Osteuropaexperten war es, dies aufzubrechen. Und man muss sagen, dass uns das natürlich auch nicht vollständig gelungen ist. Insbesondere seit 2014 haben wir dies versucht, nach dem Maidan und dem ersten Überfall auf die Ukraine. Dieser Krieg hat nicht erst dieses Jahr begonnen. Wir sind nicht durchgedrungen, zumindest nicht bis in die Politik, nicht bis zu den Entscheidern, aber letztendlich auch nicht in der Öffentlichkeit. Und selbstkritisch sei hinzugefügt: wenn man sich unsere eigene Vita anschaut oder auch wenn ich mir meine Vita anschaue, dann sieht man natürlich auch bei mir, dass ich wahrscheinlich auch zu sehr auf Moskau und Russland fixiert war“, so Behrends.„Aber was ich damit sagen will, ist sozusagen natürlich die Geschichten, die wir uns erzählen, über diese 30 Jahre sehr unterschiedlich sein können, je nach der Perspektive, die wir einnehmen. Das ist eine andere Geschichte, wenn wir sie aus Moskau erzählen, als wenn wir den Blick aus Kiew oder Tbilissi, Warschau oder Riga einnehmen. Und das müssen wir uns immer wieder klarmachen, glaube ich, weil das auch wir nur so dahin kommen können, auch die Leute vor Ort zu verstehen, weil die natürlich auch auf diese Transformationserfahrungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln schauen.“„Es ist in Deutschland zu selten gesehen worden, und da rede ich noch nicht mal über Ostmitteleuropa, über Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei. Das sind natürlich auch spezifische Geschichten, die wir, die wir wahrnehmen können, wo man aber irgendwann auch fragen muss, ist das denn wirklich noch für uns Osteuropa? Also ich habe mir angewöhnt, das nicht mehr zu sagen, wenn ich nach Prag fahre, ich fahre nach Osteuropa, sondern das ist für mich Mitteleuropa, das ist südlich, südwestlich von Berlin, und da sollte man dann auch irgendwann sozusagen die alten Kategorien aufgeben. Aber das ist vielleicht auch Teil dieses Prozesses.“
„Da sieht man natürlich auch, dass das der Blick eben auf diese Epoche bei uns sehr stark durch die deutsche Einheit geprägt ist. Oder man könnte auch sagen verstellt ist.“
„Aber das ist vielleicht auch ein Zeichen noch dieser Tod Gorbatschows auch gewesen für diese enge Verbindung zwischen Berlin und Moskau, die ja lange gepflegt wurde, die zur historischen Ostpolitik der SPD dazugehört, die natürlich im Kalten Krieg ihren Sinn hatte, weil man in Bonn wusste, dass in Moskau der Schlüssel zur Einheit liegt, weil Staaten wie die DDR oder Polen nicht souverän waren. Wenn Bonn im Kalten Krieg verhandeln wollte, dann musste man mit dem Kreml sprechen. Die Frage, die sich nach 1989 stellte, ist, ob man die neue Pluralität Osteuropas, die seit den 90er Jahren da ist, in Deutschland, im Auswärtigen Amt, in der SPD, aber auch in der CDU eigentlich genug verstanden hat? Oder hat man nicht doch nach einer kurzen Phase in den 90er Jahren, wo Deutschland sich durchaus auch für polnische, baltische oder sogar auch ukrainische Belange eingesetzt hat, wieder schnell zur Achse Berlin-Moskau zurückgekehrt ist, was mit dem entsprechenden Entsetzen in Osteuropa bei unseren Nachbarn wahrgenommen wurde“, fragt Behrends.
„Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass auch da etwas zu Ende gegangen ist und dass es auch da keinen Weg mehr zurück gibt in die Welt vor dem Februar 2022.“
„Worum geht es bei diesem Krieg? Das ist natürlich auch eine zentrale Frage. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Das wollen wir heute Abend nicht verschweigen, sondern diskutieren. Es gibt eben diejenigen, die sagen, der Westen trägt eine Mitschuld an diesem Krieg durch die Ausweitung der EU, durch die Ausweitung der NATO nach Osteuropa. War das denn nötig? War das der richtige Weg? Und auch das habe ich versucht zu diskutieren, damals in meiner Vorlesung in Frankfurt oder aber auch in Seminare. Meine These ist, dass in den 90er Jahren viele Weichen gestellt wurden. Es wurde nicht der Weg in den Krieg in den 90er Jahren vorgezeichnet, aber in den 90er Jahren, das ist mein Urteil als Zeithistoriker, hat sich vielleicht mehr entschieden, als uns lange klar war. Wir haben vielleicht über viele Dinge hinweggesehen, die tatsächlich in den 90er Jahren schon deutlich waren, als unterschiedliche Länder verschiedene Wege eingeschlagen haben. Das Resultat dieser Entscheidungen, dieser verschiedenen Wege, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt sehen und was ich natürlich auch in diesem Ost-West-Konflikt ganz deutlich zeigt. Was sind nun diese einzelnen Schritte? Wie kamen sie zustande? Wie können wir den russischen Weg und den ukrainischen Weg aus dem Kommunismus verstehen?“
„Kyjiw und Moskau waren sich zu sowjetischer Zeit ähnlich. Es war nicht so, dass man in der sowjetischen Ukraine plötzlich das Gefühl hatte, das ist ja alles viel freier als in Russland. Trotzdem sind diese Gesellschaften 30 Jahre später unterschiedlich aufgestellt. Wir haben die Prozesse ungenügend verstanden, die diese Differenzen möglich gemacht haben. Da gibt es in der Politik und in der Forschung Nachholbedarf.“
Für Behrends ist „das größte Problem der deutschen Öffentlichkeit in Bezug auf Osteuropa, die Ignoranz. Wir reden lieber über uns und unsere Befindlichkeit.“
„Man wird zukünftig analysieren müssen, was für eine Ostpolitik Deutschland nach der Einheit gemacht hat. Ich sehe da einen Bruch zu der Ostpolitik vor der Einheit. Ich glaube allerdings, dass der Mythos der Brandtschen Ostpolitik dabei geholfen hat, eine Russlandpolitik zu etablieren, die nur wenig mit Brandts Anliegen gemein hatte.“
„Wie sieht eine europäische Ordnung aus, die wir nach diesem Krieg anstreben, auch als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen? Wohin soll es eigentlich nach dieser Erschütterung gehen? Welche Pflöcke können wir einschlagen und sagen, das sind unsere Orientierungspunkte, die einen Weg in die Zukunft weisen. Der Blick in die Geschichte kann, glaube ich, helfen zu erkennen, zumindest auf welchen Holzwegen wir waren. Und vielleicht gelingt es uns auch, das Verhältnis zwischen den sozialdemokratischen Grundbegriffen Frieden und Freiheit neu auszutarieren. Zu oft standen wir zuletzt – um des Friedens willen – an der Seite der Tyrannei.“
„Wir können ganz klar sehen, wer in diesem Krieg der Aggressor und wer der Verteidiger ist. … völkerrechtlich gibt es da keine Zweifel. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir diese Verantwortung Russlands deutlich benennen und noch hinzufügen, dass der Angriff 2014 begann. Damals hatten die Mehrheit der Deutschen Probleme hatten, das Offensichtliche zu erkennen und zu benennen.“
„Da gibt es Vieles, Vieles liegt wirklich auf dem Tisch, so Klaus Jürgen Scherer. „Da sind auch aus ihrer intimen Kenntnis der osteuropäischen Verhältnisse dieses differenzierte Bild der verschiedenen Länder, weil eigentlich ist die Debatte doch bei uns, es gibt ein Riss sozusagen durch Europa, da ist eben der Westen für mit all dieser sozusagen jahrzehntelangen, auch europäischen Erfahrung. Und auf der anderen Seite sind eben diese osteuropäischen Länder, wo wir eigentlich nicht verstehen oder wo wir gehofft haben oder gemeint haben, na ja, wenn er sich sozusagen Marktwirtschaft, Wohlstand durch die EU sozusagen dann doch durchsetzt, auch ein Stück mehr soziale Sicherheit entsteht usw, dass das dann eigentlich dazu führt, dass sie auch einen selbstverständlich demokratischen Weg gehen. Und die Diskussion ist ja sonst immer so, die haben halt die für uns unverständlichen nationalistisch Autoritären auch manchmal von einem Christentum geprägt, wie man das jetzt hier in Deutschland selbst bei den Katholiken nicht mehr kennt, dass also sozusagen auch Kultur reaktionär ist, gewissermaßen autoritäre Verhältnisse, die akzeptiert und da steht man ja eigentlich, so sagen wir mal, etwas ratlos davor. Als ignoranter Westler sage ich mal und wie differenziert man nicht so richtig. Wie würden Sie denn darauf auf so etwas noch mal reagieren?“
Behrends sagt, dass man sich jedes Land genau ansehen muss. „Auch da lohnt sich der, der differenzierte Blick. Und dann häufig natürlich auch diese Verengung auf Stereotypen. Ich habe das jetzt bei der Ukraine auch gemerkt. Natürlich ist die Ukraine keine Westminster-Demokratie.“
„Was man aber sehen muss, ist, dass das gerade die junge Generation und wenn man nach Belarus schaut, die Frauen haben doch über einen europäischen Ideenhorizont verfügen. Wenn man sich diese Proteste auch anschaut vor zwei Jahren in Belarus, dann ging es dort um freie Wahlen und Menschenrechte. Genuin westliche Werte, es ging auch um soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, alles sozialdemokratische Anliegen, aber trotzdem war unsere Unterstützung nur lauwarm. Mancher ist vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt worden, weil das natürlich auch mit nationalen Symbolen einhergeht, dass die Leute mit der belarussischen oder ukrainischen Fahne herumlaufen. Und der eine oder andere hat vielleicht auch ein Kreuz oder so, weiß ich nicht. Aber auch da lohnt es sich vielleicht mal genau hinzuschauen.“
„Die Polen haben einen emphatischen Freiheitsbegriff, der in den Aufständen des 19. Jahrhunderts und dem Warschauer Aufstand entstand. Wenn die Polen diesen genuin antiimperialen Krieg in der Ukraine sehen, dann unterstützen sie ihre Nachbarn, ganz gleich, ob sie politisch liberal oder national-katholisch sind. Sie erkennen in den Ukrainern ihr eigenes Schicksal und unterstützt diesen Kampf, weil Polinnen und Polen ganz in dieser Freiheitstradition groß geworden sind. Das ist etwas, was uns in Deutschland fehlt, weil wir eben keinen erfolgreichen Freiheitskampf gehabt haben. Uns ist die Freiheit gebracht worden von den Alliierten.“
Behrends glaubt, „dass wir in Deutschland ein Problem damit haben, dass dieser – das ist natürlich ein grauenhaftes Szenario – dieser Konflikt auf dem Schlachtfeld entschieden wird und nicht am Verhandlungstisch. Wir haben gedacht, oder wir haben uns die Geschichte erzählt, die ahistorisch ist, wenn jeder, dass es diese Logik des Krieges in Europa nicht mehr geben wird, dass politische Konflikte friedlich entschieden werden, das ist eine Geschichte, nach der friedlichen Revolution von 1989 30 Jahre lang gegenseitig erzählt haben. Viele würden gern daran festhalten. Dabei müssen wir leider akzeptieren, dass es in der Ukraine zur Zeit keine Verhandlungsoptionen gibt, es ist ein genozidaler Krieg Russlands und Kyjiw hat das Recht und gegenüber der eigenen Bevölkerung die Pflicht, sich zu verteidigen. Wie der Krieg ausgeht, das weiß man nicht. Alles, was wir tun können, es der Ukraine zu helfen und eine weitere Eskalation zu vermeiden. Doch die Unsicherheit bleibt, denn: Der Krieg ist der große Sprung ins Dunkle.“
„Nur aus der Niederlage kann das neue Russland entstehen. Wie diese Niederlage dann genau aussieht, das wissen wir natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber wie gesagt, russische Staatslenker, die die Kriege verlieren, die bekommen Probleme. Ich glaube nicht, dass die russische Elite Probleme mit den Kriegsverbrechen solange man den Krieg gewinnt, aber in dem Moment, wo der Kreml den Krieg verliert, da schwindet die Legitimität des Machthabers.“
„Es ist auch ein Krieg, der um die europäische Ordnung geführt wird. Es geht um die Existenz der Ukraine, aber auch um die europäische Ordnung, um das Völkerrecht. Letztendlich geht es um die Frage, ob osteuropäische Staaten genauso souverän sind wie westeuropäischen Staaten.“
Für Klaus Jürgen Scherer war „das eine sehr lebendige Schilderung des Ganzen. Und wie immer, wenn man so über diese historischen und politischen Themen redet, dann hat man Ende mehr Fragen als vorher. Ich sage mal für mich, ein Fazit dieser ganzen Situation ist, warum wir auch sozusagen die Historiker zurecht jetzt gefragt werden. Im Grunde ist die Geschichte wieder zurück. Also wir haben doch gedacht, in vielerlei Hinsicht, dass es die Posthistorie, posthistorische Zeiten in der Soziologie sozusagen ein Begriff auch gewesen, wo man dachte ja, dass das Soldatische und das Machtpolitische und das Carl- SchmittIsche vorbei ist und irgendwie der Vergangenheit angehört, weil wir doch seit 68 andere Charaktere geworden sind, das Autoritäre überwunden haben. Genau das Nationale überwunden haben, europäisch denken oder eigentlich uns als Weltbürger fühlen. Wir haben ja immerhin die Wiedervereinigung. Und wir haben auch einiges erreicht. Aber ich will damit nur sagen die Lage ist, so glaube ich, es ist doch so, und das fand ich jetzt sehr beeindruckend, dass man immer wieder aus der fernen Vergangenheit, wie soll ich sagen, mit Parallelen und mit Unterschieden sozusagen argumentieren kann. Und die Geschichte ist zurück. Das ist mein Fazit.“
Jan C. Behrends, Historiker und Hochschullehrer an der Universität Viadrina Frankfurt/Oder. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Zeitgeschichte Osteuropas, Stadtgeschichte, europäische Diktaturen, Gewaltforschung und die post-sowjetische Zeit. Im März 2022 wurde Behrends, der am ZZF in Potsdam arbeitet, auf eine Sonderprofessur an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder berufen. Am 16. Mai 2022 hielt er dort seine Antrittsvorlesung über „Das Ende der postsowjetischen Epoche oder die Bedeutung der 1990er Jahre für das 21. Jahrhundert“, in der er den russischen Angriff auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 als Ende der post-sowjetischen Epoche bezeichnete.
Klaus-Jürgen Scherer (*1956), Dr. phil., Diplompolitologe, war u. a. langjähriger Geschäftsführer des Wissenschafts- und des Kulturforums der Sozialdemokratie. Seit 2007 Redaktionsmitglied Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte. Geschäftsführender Vorstand der HDS e. V. und leitender Redakteur der Halbjahreszeitschrift perspektivends.
Impressionen
Bilder: Marco Urban. www.marco-urban.de,